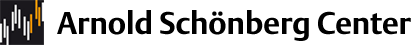Die Bilder Schönbergs zerfallen in zwei Arten: die einen sind direkt nach der Natur gemalte Menschen, Landschaften; die anderen – intuitiv empfundene Köpfe, die er »Visionen« nennt. Die ersten bezeichnet Schönberg selbst als ihm notwendige Fingerübungen, legt keinen besonderen Wert auf sie und stellt sie nicht gern aus. Die zweiten malt er (ebenso selten wie die ersten), um seine Gemütsbewegungen, die keine musikalische Form finden, zum Ausdruck zu bringen.
Diese beiden Arten sind äusserlich verschieden. Innerlich stammen sie aus einer und derselben Seele, die einmal durch die äussere Natur zum Vibrieren gebracht wird, ein anderes Mal – durch die innere.
Diese Teilung ist natürlich nur im allgemeinen bezeichnend und ist stark schematisch gefärbt.
In weiterer Wirklichkeit kann man die äusseren und inneren Erlebnisse nicht so schroff voneinander teilen. Beide Arten Erlebnisse haben sozusagen viele lange Wurzeln, Fasern, Zweige, die sich gegenseitig durchdringen, sich umeinander wickeln und im letzten Resultat einen Komplex bilden, welcher für die Künstlerseele bezeichnend ist und bleibt. Dieser Komplex ist sozusagen das Verdauungsorgan der Seele, seine umgestaltend-schöpferische Kraft. Dieser Komplex ist der Urheber der umgestaltenden inneren Tätigkeit, die sich in umgestalteter äusserer Form manifestiert. Durch die jedesmal eigenartigen Eigenschaften dieses Komplexes produziert der kunstbildende Apparat des einzelnen Künstlers Werke, die, wie man sagt, seinen »Stempel« auf sich tragen und die »Handschrift« des Künstlers erkennen lassen. Natürlich sind diese beliebten Bezeichnungen ganz oberflächlich, da sie nur das Aeussere, das Formelle betonen und das Innere beinahe vollkommen aus dem Spiel lassen. Das heisst, hier wird – wie so oft – überhaupt dem Aeusseren zu viel Ehre erwiesen.
Bei dem Künstler wird das Aeussere durch das Innere nicht nur bestimmt, sondern auch geschaffen, wie in jeder anderen Schöpfung bis zur kosmischen hinauf. Von diesem Standpunkt aus gesehen, lassen uns die malerischen Werke Schönbergs unter dem Stempel seiner Form seinen seelischen Komplex erkennen. Erstens sehen wir sofort, dass Schönberg malt, nicht um ein »schönes«, »liebenswürdiges« usw. Bild zu malen, sondern dass er beim Malen sogar eigentlich an das Bild selbst nicht denkt. Auf das objektive Resultat verzichtend, sucht er nur seine subjektive »Empfindung« zu fixieren und braucht dabei nur die Mittel, die ihm im Augenblicke unvermeidlich erscheinen. Nicht jeder Fachmaler kann sich dieser Schaffensart rühmen! Oder anders gesagt: unendlich wenige Fachmaler besitzen diese glückliche Kraft, zeitweise diesen Heroismus, diese Entsagungsenergie, welche allerhand malerische Diamanten und Perlen, ohne sie zu beachten, ruhig liegen lassen oder sie gar wegwerfen, wenn sie sich ihnen von selbst in die Hand drücken. Schönberg geht geradeaus, seinem Ziele entgegen, oder durch sein Ziel geleitet nur dem hier notwendigen Resultat entgegen.
Der Zweck eines Bildes ist: in malerischer Form einem inneren Eindruck einen äusseren Ausdruck zu geben. Das mag wie eine bekannte Definierung klingen! Wenn wir daraus die logische Konsequenz ziehen, dass das Bild gar keinen anderen Zweck hat, so möchte ich fragen: wieviel Bilder sind als klare, durch Unnötiges nicht getrübte Werke zu bezeichnen? Oder: wieviel Bilder bleiben in Wirklichkeit nach dieser harten, unbiegsamen Prüfung Bilder? Und nicht »objets d’art«, die die Notwendigkeit ihrer Existenz betrügerisch vortäuschen?
Das Bild ist ein äusserer Ausdruck eines inneren Eindrucks in malerischer Form.
Wer diese Definierung des Bildes nach sorgfältiger genauer Prüfung annimmt, der bekommt in ihr einen richtigen und, was zu betonen ist, einen unveränderlichen Massstab für jedes Bild, ganz gleich, ob es, erst heute entstanden, noch nass auf der Staffelei steht oder bei der Ausgrabung einer durch lange Zeit in der Erde verhüllten Stadt als Wandmalerei entdeckt wird.
Es verändert sich bei Annahme dieser Definierung gar manche »Ansicht« in Kunstfragen. Im Vorbeigehen möchte ich hier so eine Ansicht mit dem Lichte der obigen Definierung aus der Nacht der gewohnten Vorurteile herausreissen. Nicht nur die Kunstschriftsteller und das Publikum, sondern auch in der Regel die Künstler selbst sehen im »Werdegang« eines Künstlers das Suchen nach der diesem Künstler entsprechenden Form.
Aus dieser Ansicht entstehen oft verschiedene giftbildende Folgen.
Der Künstler meint, dass er, nachdem er »endlich seine Form gefunden hat«, jetzt ruhig weiter Kunstwerke schaffen kann. Leider merkt er gewöhnlich selbst nicht, dass von diesem Moment (des »ruhig«) er sehr bald diese endlich gefundene Form zu verlieren beginnt.
Das Publikum (teilweise unter Leitung der Kunsttheoretiker) bemerkt diese Wendung nach rückwärts nicht so bald und füttert sich mit Erzeugnissen einer absterbenden Form. Andererseits von der Möglichkeit des »endlichen Erreichens einer dem Künstler entsprechenden Form« überzeugt, verurteilt es scharf die noch ohne diese Form gebliebenen Künstler, die eine Form nach der anderen abwerfen, um die »richtige« zu finden. Die Werke solcher Künstler bleiben ohne die ihnen gebührende Beachtung, und das Publikum versucht nicht, den ihm nötigen Inhalt aus diesen Werken herauszusaugen.
Es entsteht also ein vollkommen verkehrtes Verhältnis zur Kunst, indem das Tote für das Lebende gehalten wird und umgekehrt.
In Wirklichkeit besteht der Werdegang des Künstlers nicht aus dem äusseren Entwickeln (Suchen nach Form für den unveränderten Stand der Seele), sondern aus dem inneren Entwickeln (Abspiegeln der seelisch erreichten Wünsche in der malerischen Form).
Es wächst der Inhalt der Seele des Künstlers, er präzisiert sich und nimmt in den inneren Dimensionen zu: nach oben, nach unten, zu allen Seiten. In dem Augenblicke, in welchem eine gewisse innere Stufe erreicht wird, stellt sich die äussere Form dem inneren Wert dieser Stufe zur Verfügung.
Und andererseits: in dem Augenblick, in welchem das innere Wachsen zum Stehen gebracht wird und also auch sofort dem Abnehmen der inneren Dimensionen zum Opfer fällt, entschlüpft dem Künstler auch »die schon erreichte« Form. So sehen wir oft dieses Absterben der Form, welches das Absterben des inneren Wunsches ist. So verliert oft ein Künstler die Herrschaft über seine eigene Form, die matt, schwach, schlecht wird. Dadurch erklärt sich das Wunder, dass ein Künstler plötzlich z. B. nicht mehr zeichnen kann, oder dass seine früher lebendige Farbe als lebloser blosser Schein, als ein malerisches Aas auf der Leinwand liegt.
Die Dekadenz der Form ist die Dekadenz der Seele, das heisst des Inhaltes. Und das Wachsen der Form ist das Wachsen des Inhaltes, das heisst der Seele.
Wenn wir den bezeichneten Massstab an die malerischen Werke Schönbergs anlegen, so sehen wir sofort, dass wir hier mit Malerei zu tun haben, mag diese Malerei »abseits« von der grossen »heutigen Bewegung« stehen oder nicht. Wir sehen, dass in jedem Bild Schönbergs der innere Wunsch des Künstlers in der ihm passenden Form spricht. Ebenso wie in seiner Musik (soviel ich als Laie behaupten darf) verzichtet auch in seiner Malerei Schönberg auf das Ueberflüssige (also auf das Schädliche) und geht auf direktem Wege zum Wesentlichen (also zum Notwendigen). Alle »Verschönerungen« und Feinmalereien lässt er unbeachtet liegen. Sein »Selbstporträt« ist mit dem sogenannten »Palettenschmutz« gemalt. Und welches Farbenmaterial könnte er sonst wählen, um diesen starken, nüchternen, präzisen, knappen Eindruck zu erreichen? Ein Damenporträt zeigt in der Farbe mehr oder weniger ausgesprochen nur das kränkliche Rosa des Kleides – sonst keine »Farben«. Eine Landschaft ist graugrün, nur graugrün. Die Zeichnung ist einfach und richtig »ungeschickt«. Eine »Vision« ist auf einer ganz kleinen Leinwand (oder auf einem Stück Verpackungspappe) nur ein Kopf. Stark sprechend sind nur die rot umrandeten Augen.
Ich möchte die Schönbergsche Malerei am liebsten die Nurmalerei nennen. Schönberg selbst wirft sich die »mangelnde Technik« vor. Ich möchte diese Vorwürfe nach dem oben gegebenen Massstab ändern: Schönberg täuscht sich – er ist nicht mit seiner Maltechnik unzufrieden, sondern mit seinem inneren Wunsch, mit seiner Seele, von der er mehr verlangt, als sie heute geben kann. Diese Unzufriedenheit möchte ich jedem Künstler wünschen – für alle Zeiten. Es ist nicht schwer, äusserlich weiter zu kommen. Es ist nicht leicht, innerlich fortzuschreiten.
Es möge uns das »Schicksal« gönnen, dass wir das innere Ohr von dem Munde der Seele nicht abwenden.
Arnold Schönberg. Mit Beiträgen von Alban Berg et al. München 1912, p. 59–64